Künstliche Intelligenz, sage mir die Krankheit
- Bülent Erdogan

- 13. Apr. 2018
- 8 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 18. Sept. 2018
Wie ein Versprechen auf die Zukunft mutete vor wenigen Jahren IBMs Computerprogramm "Watson" an - auch in der Medizin. Doch lassen Durchbrüche noch auf sich warten, je nachdem, welche Maßstäbe man ansetzt und welche Hoffnungen in sie.

Wer Visionen habe, so polterte einst Altbundeskanzler Helmut Schmidt (1918–2015), solle zum Arzt gehen. Immerhin können Visionen als eine gnädige Angelegenheit beschrieben werden: der Visionär kann sich als Pionier des Fortschritts in Szene setzen und im gleichen Atemzug auf eine hinreichend unbestimmte Zukunft verweisen, in welcher die in Rede stehende Vision dereinst Realität werde. Wie ein ebensolches Versprechen auf die Zukunft mutet IBMs Computerprogramm "Watson" an. Wird diesem Vertreter Künstlicher Intelligenz (KI) in digitaler Form eine Frage gestellt, so stellt er nach einer Analyse aller ihm vorliegenden Texte und Datenbanken anhand von linguistischen Modellen und Algorithmen eine Reihe von Hypothesen auf, deren Wahrscheinlichkeit er analysiert und bewertet. Bemüht man die Google-Suche, so begegnet einem KI als Verheißung auf die Ablösung des Menschen als intelligentester Lebensform dieses Planeten. 2011 besiegte Watson zwei Cracks der US-Quizshow "Jeopardy!" Es folgten Ankündigungen und Meldungen wie jene aus dem Jahr 2016, wonach Watson bei einer Patientin anhand einer Analyse genetischer Daten eine seltene Form der Leukämie innerhalb weniger Minuten diagnostiziert habe.
Privatdozent Dr. Sven Zenker, Uni Bonn
"Welcher Mensch kann schon terabyteweise Bilddaten bis auf das letzte Pixel fehlerfrei mit hoher Spezifität und Sensitivität analysieren?"
Privatdozent Dr. Sven Zenker, Leiter Perioperative Medizintechnik und Medizinische Informatik und Leiter der Arbeitsgruppe Angewandte Mathematische Physiologie (AMP AG) an der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin der Uniklinik Bonn, sieht in Watson und ähnlichen, algorithmisch basierten Anwendungen zur Entscheidungsunterstützung durchaus spannende Entwicklungen, die abseits von Einzelfällen aber noch meilenweit entfernt von einer Nutzung in der klinischen Medizin sind. "Ich erachte es schon für sinnvoll, solche Ansätze in Pilotprojekten zu evaluieren", sagt der Anästhesist. Bislang stehe der Nachweis von Wirkung und Nutzen aber oftmals aus, ebenso der Nachweis der Sicherheit. Er sehe keinen Grund, warum man in diesem Bereich hinter den Standards evidenzbasierter Medizin zurückbleiben sollte. Zenkers Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit der Nutzung mechanistischer mathematischer Modelle physiologischer und pathophysiologischer Prozesse zur quantitativen Interpretation von akutmedizinischen Monitoring-Daten. Er verweist auf eine Studie aus den USA, bei der ein Computer anhand von Vitalparametern einen Score für das Risiko von Frühchen errechnete, eine Sepsis zu erleiden. "Auch wenn hier nicht Cognitive Computing im engeren Sinne, sondern eine Kombination aus klassischer Biosignalanalyse und statistischer Modellierung zum Einsatz kam, gelang in einer randomisierten, prospektiven Studie tatsächlich der Nachweis, dass schon die Präsentation dieser zusätzlichen, auf aufwändiger quantitativer Analyse beruhender Information am Patientenbett messbar Outcomes verbessern kann", sagt der Oberarzt. Viele der algorithmischen Anwendungen à la Watson machten Vorschläge oder gäben Wahrscheinlichkeiten an, ohne dass für den Nutzer nachvollziehbar sei, wie das Ergebnis zustande gekommen ist, sagt Zenker. "Eine Argumentationskette oder ein Verweis auf Quellen fehlt." Gebe der Rechner zum Beispiel eine Erfolgswahrscheinlichkeit
von 80 Prozent für Therapie A und eine von 70 Prozent für Therapie B aus, stehe der Arzt weiter vor einer schwierigen Entscheidung. "Der Algorithmus übernimmt eben keine Verantwortung."
Für einzelne, klar definierbare Bereiche, die den Menschen aufgrund einer hohen Datendichte überfordern, sieht Zenker durchaus heute bereits Felder für das Cognitive Computing. So seien schon heute Programme zur Analyse von Langzeit-EKGs oder die quantitative Bildanalyse in der Radiologie im Einsatz: "Denn welcher Mensch kann schon terabyteweise Bilddaten bis auf das letzte Pixel fehlerfrei mit hoher Spezifität und Sensitivität analysieren? Schritt für Schritt werden wir in Teilbereichen wie diesen immer potentere Algorithmen erleben, weil sie medizinisch wie wirtschaftlich Vorteile haben werden." Es gebe viele, ganz offensichtliche Einsatzbereiche. Allerdings sei es ein langer Weg von der Grundlagenforschung bis ans Patientenbett. Und wer solche Systeme einführen wolle, müsse sich ebenso dem Qualitätsmanagement stellen, so Zenker. Was sich allerdings nicht in elektronische Datenbanken einspeisen lasse, zum Beispiel menschliche Wahrnehmung im Klinikalltag, das könne auch nicht von Software ausgewertet werden.
Bericht im US-Magazin "Statnews"
"IBM pitched its Watson supercomputer as a revolution in cancer care. It’s nowhere close."
IBM hat mit Watson und der Idee vom Cognitive Computing große Erwartungen (neu) geweckt und so manchen publizistischen Zeitgenossen in der Vergangenheit zu Lobeshymnen auf eine glorreiche digitale Zukunft hingerissen. Doch Papier ist geduldig. Ob Watson ein Fall für den Doktor ist, als Kollege oder Patient, das können wir dem milden Urteil künftiger Chronisten überantworten. Am M.D. Anderson Cancer Center in Houston/Texas zog man im Frühjahr indes den Stecker. Laut dem US-Magazin Forbes entwickelte sich Watson finanziell zu einem Fass ohne Boden. "IBM pitched its Watson supercomputer as a revolution in cancer care. It’s nowhere close", titelte kürzlich das US-Magazin Statnews.com.
An Lösungen für den medizinischen Katastropheneinsatz auf Basis kamerabasierter Sensorik feilt Privatdozent Dr. Dr. Michael Czaplik. Gemeinsam mit seinem Team hat er eine Daten-Brille entwickelt, die es Ersthelfern, seien es Ärzte, Sanitäter oder Laien, erleichtern soll, auch bei Stress richtige Entscheidungen zu treffen. Features sind ein Sichtungsalgorithmus, eine Standard-Vorgehensweise (SOP) für den Umgang mit Verletzten, die unter Schmerzen leiden und die Option, einen Tele-Arzt zuzuschalten und diesem mittels eingebauter Kamera live ein Lagebild geben zu können. "Für den Helfer vor Ort bringt das im Umgang mit einer für ihn schwierigen und oft hochkomplexen Situation mehr Sicherheit mit sich", sagt der Oberarzt und Leiter der Sektion Medizintechnik der Klinik für Anästhesiologie
an der Uniklinik Aachen. Gerade die Anästhesiologie sei durch eine große Interdisziplinarität und Kooperation mit anderen ärztlichen Fächern geprägt, sagt er. Auch im regulären Betrieb einer Klinik könne digitale Unterstützung daher wichtige Dienste leisten: "Jede Disziplin hat ihre eigenen Leitlinien und Besonderheiten. Daten-Brillen können uns an der Behandlung beteiligten Anästhesiologen
kontextadaptiertes Wissen bereitstellen."
Doch Czaplik kann sich noch mehr vorstellen: Kamerabasierte Sensorik, kombiniert mit Vorwissen über Personen, soll eines Tages dazu beitragen, zum Beispiel im häuslichen Umfeld Zustandsverschlechterungen bei Patienten frühzeitig zu erkennen und Krisen abzuwenden. Schon heute sei es möglich, aus kurzer Entfernung
mittels Radarwellen die Thoraxexkursion zu beobachten und damit den Herzschlag zu erfassen. Czaplik plädiert für mehr Offenheit gegenüber technologischen Neuerungen: "Wenn wir uns Innovationen kategorisch verschließen, werden wir über kurz oder lang den Anschluss verpassen." Zwar liege der Tag, an dem der Mensch akzeptieren werde, mit einem Roboter statt mit einem Menschen zu sprechen, noch in weiter Ferne. „Aber er wird irgendwann kommen“, ist Czaplik überzeugt. Innovative Technik könne die Lücken schließen, wenn demografisch bedingt nicht mehr an jedem Ort und in jeder Situation zum Beispiel qualifizierte Ärzte ihren Dienst tun, weil es schlicht weniger Mediziner gibt oder ihre Zeit nicht mehr reicht für die wachsende Zahl älterer, multimorbider Patienten, sagt der Aachener Mediziner, der kürzlich mit einer Arbeit zur elektrischen Impedanztomographie zum Dr. rer. nat. promoviert hat. "Technologie kann dann einen Beitrag dazu leisten, dass auch weniger qualifizierte, aber geschulte Personen richtige Entscheidungen treffen – mit dem Arzt im Hintergrund."
Professor Dr. Torsten Kuhlen, RWTH Aachen
"Kraftrückkopplung in der virtuellen Realität ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Solche Geräte zu bauen, stellt ein inhärentes Problem dar. Da warten wir immer noch auf einen Durchbruch."
Professor Dr. Torsten Kuhlen gehört deutschlandweit zu den Pionieren der Virtual Reality (VR). Der Informatiker leitet das Lehr- und Forschungsgebiet Virtuelle Realität und Immersive Visualisierung (VCI) der RWTH Aachen. Zu seinen Projekten gehörte seit der Jahrtausendwende beispielsweise die Simulation der Regionalanästhesie per bimanueller Nadelintervention zum Training von Ärztinnen und Ärzten "Herausforderungen waren die zu simulierende Deformation des Gewebes bei Palpation, das haptische Feedback, also die Kraftrückkopplung an den Nutzer, die Visualisierung und die Berechnung von Kollisionen, und das alles in Echtzeit." Für die Grafik reicht dabei eine Bildwiederholungsrate von 20 bis 60 Hertz aus. "Für die Kraftrückkopplung braucht man hingegen 1.000 Hertz und mehr und damit eine ausreichende Rechenkapazität." Im Verlauf des Projekts wurde die virtuelle Realität um ein simuliertes Ultraschall-Bild erweitert.
Beschäftigt hat man sich in Aachen auch mit der offenen Chirurgie, zum Beispiel der Simulation von Skalpell-Schnitten. Ein Problem: Die Simulation basiert auf einem Gitternetz. In dem Moment, in dem nun ein Schnitt simuliert wird, zerstört man damit die Gitterstruktur, also die Topologie, auf der die Simulation beruht. Kuhlen: "Entsprechend aufwändig muss die Simulation immer wieder neu gerechnet werden."
In einem weiteren Projekt haben Kuhlen und Co. die Manipulation des Kieferknochens zur Korrektur eines Unter- oder Überbisses simuliert. Dazu wird der Kieferknochen mittels zweier Meißel aufgebrochen. Zielsetzung der zu entwickelnden Software war, die dafür notwendige drehende Handbewegung zu trainieren und die Folgen, also Erfolg oder Misserfolg (den "bad split"), zu simulieren, unter anderem mit der grafischen Darstellung der Wirkung des Eingriffes auf den Kiefer. Dabei sollte dem Simulationsteilnehmer am Joystick auch ein haptisches Feedback gegeben werden. Doch noch stoßen Soft- und Hardware an ihre Grenzen: "Kraftrückkopplung in der virtuellen Realität ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Solche Geräte zu bauen, stellt ein inhärentes Problem dar. Da warten wir immer noch auf einen Durchbruch", sagt Kuhlen. Bis auf Weiteres hat
sich das VCI daher aus dem Simulationsfeld der offenen Chirurgie zurückgezogen.
In puncto VR konzentriert man sich in Aachen derzeit auf das Human Brain Project, für das die RWTH mit dem Forschungszentrum Jülich zusammenarbeitet. Zum Einsatz kommt dabei die aixCave, eine der weltweit größten VR-Installationen mit einer Grundfläche von circa 25 Quadratmetern und mehr als drei Metern Höhe. In dem stereoskopischen Visualisierungskäfig mit 4K-Auflösung, der Assoziationen an das Holodeck der Science-Fiction-Saga "Raumschiff Enterprise – das nächste Jahrhundert" weckt, können Neurowissenschaftler zum Beispiel ein Gehirn in einer 360-Grad-Rundumsicht als 3D-Modell erkunden. An der Medizinischen Fakultät der Universität Ulm können Medizinstudierende seit dem Wintersemester 2016/2017 das Herz mittels VR-Brille in 3D erkunden und auch "begehen". In Schweden haben Forscher untersucht, inwieweit sich Augmented Reality bei Menschen mit amputiertem Arm einsetzen lässt, um Phantomschmerzen zu lindern. Dazu befestigten sie Sensoren auf dem Armstumpf, der einem Computer Werte übermittelte, mit dem dieser auf einem Bildschirm den fehlenden Arm simulierte. Diesen setzten die die Probanden dann zum Beispiel bei einem Autorennspiel ein.
Seit bald 20 Jahren, zunächst in den USA und seit einigen Jahren auch hierzulande, ist "DaVinci" im Einsatz, ein minimal-invasiver, vierarmiger OP-Roboter, der zunächst für die Prostatektomie eingesetzt wurde. Inzwischen wird der Roboter der kalifornischen Firma Intuitive Surgical auch für Eingriffe an der Blase, des Harnleiters, der Niere oder der Speiseröhre verwendet. Gesteuert wird DaVinci per Joysticks von einer Operationskonsole aus, die dem Operateur eine hochauflösende 3D-Darstellung mit bis zu zehnfacher Vergrößerung und eine Software gegen zitternde Hände bietet. Ein haptisches Feedback seiner Aktionen erhält der Chirurg indes nicht. Und eine im Juli 2016 veröffentlichte randomisiert-kontrollierte Phase-3-Studie mit etwa 300 Patienten, die zwischen August 2010 und November 2014 rekrutiert worden waren, konnte nach sechs und zwölf Wochen nach Operation keine Unterschiede zwischen der offenen, manuellen Operationsmethode und der roboterunterstützten,
laparoskopischen Methode feststellen.
Eine humanoide Maschine ist DaVinci nicht, er reagiert nur auf Joystick-Befehl, er lernt nicht selbst dazu, wie Künstliche Intelligenz dies laut Darstellungen vermag, sondern er ist im besten Sinne ein ziemlich großes OP-Instrument, ein Telemanipulator in einem Master-Slave-Verhältnis. Auch den Schnitt und die Einstiche in den Patienten nimmt weiterhin der Chirurg manuell vor. Dieses Master-Slave-Verhältnis trifft auch für den Roboter Rosa zu, der bei Eingriffen im Gehirn und an der Wirbelsäule assistiert.
Die Uniklinik Schleswig-Holstein (UKSH) am Campus Kiel hat ihren Maschinenpark, oder soll man sagen: Mitarbeiterstamm, kürzlich um zwei Roboter erweitert. Die putzig anzuschauenden Maschinen des belgischen Herstellers Zora Robotics sind 59 Zentimeter groß, rund 4,5 Kilogramm schwer und sollen die Klinik-Clowns bei der Visite in der Kinderklinik begleiten. Zora Bot verfügt über 20 Sprachmodule. "Ziel ist es, Kindern eine Abwechslung vom Krankenhausalltag zu verschaffen und Berührungsängste abzubauen. In Kooperation mit der Physiotherapie soll der Roboter zudem helfen, Kindern therapeutische Übungen nahezubringen. Diese Einsatzmöglichkeit soll auch bei älteren Patienten auf der neurogeriatrischen Station der Klinik für Neurologie geprüft werden. Möglich ist zudem, dass Patienten mit Demenzerkrankungen von Zora profitieren können", so das UKSH. Ein weiteres Einsatzgebiet könnte die Arbeit mit Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung sein.
David Graeber, US-Anthropologe
"Kraftfelder, Teleportation, Antigravitationsfelder, Tricorder, Traktorstrahlen, Unsterblichkeitspillen. Ausgesetzte Belebung (Scheintod), Androiden, Kolonien auf dem Mars. Wo sind all diese Wunderdinge geblieben?"
Noch scheint es für die meisten Ärzte und Verantwortlichen hierzulande eher visionär, dass Roboter wie DaVinci oder Rosa automatisiert operieren, noch ist die Angst vor Unfällen mit autark agierenden Robotern zu groß. Zu Vorsicht beigetragen haben mögen auch die Erkenntnisse mit roboterunterstützten Hüftgelenksimplantaten. Sollten sich Robotersysteme, deren „Gehirn“ auf Künstlicher Intelligenz basiert, aber als medizinisch, logistisch und finanziell signifikant überlegen herausstellen, könnte auch der autonome Roboter zum Inventar von morgen gehören. Für Patienten müssen jedenfalls schon Systeme wie das Cyberknife M6 der US-Firma Accuray für die Strahlentherapie wie eine Leihgabe aus der Requisite eines Science-Fiction-Films vorkommen.
Der US-amerikanische Anthropologe David Graeber, Jahrgang 1961, hat sich in seinem 2015 erschienen Werk "Bürokratie. Die Utopie der Regeln" auch mit den technologischen Verheißungen der 1950er- und 1960er-Jahren auseinandergesetzt. "Kraftfelder, Teleportation, Antigravitationsfelder, Tricorder, Traktorstrahlen, Unsterblichkeitspillen. Ausgesetzte Belebung (Scheintod), Androiden, Kolonien auf dem Mars. Wo sind all diese Wunderdinge geblieben?", fragt Graeber und stellt sich vor, wie ein Science-Fiction-Fan der Fünfzigerjahre mit Blick auf das Internet "höchstwahrscheinlich darauf hinweisen (würde), dass wir es hier im Grunde nur mit einer superschnellen und global verfügbaren Verbindung von Bibliothek, Postamt und Versandkatalog zu tun haben". Diese Meinung ist durchaus pointiert - und wird von anderen nicht unbedingt geteilt (siehe https://www.heise.de/tr/artikel/Essay-Die-sieben-Todsuenden-der-KI-Vorhersagen-4003150.html), aber sie berührt einen Kern, der sich als latentes Unbehagen mit den Verlautbarungen tatsächlicher oder vermeintlicher Eliten auch in anderen gesellschaftlichen Kontexten äußert. Man möchte Graeber immerhin zurufen: am Tricorder, wie ihn einst der Erste Medizinische Offizier des "Raumschiffs Enterprise" einsetzte, Dr. Leonard McCoy alias "Pille", wird zumindest fleißig getüftelt, siehe tricorder.xprize.org

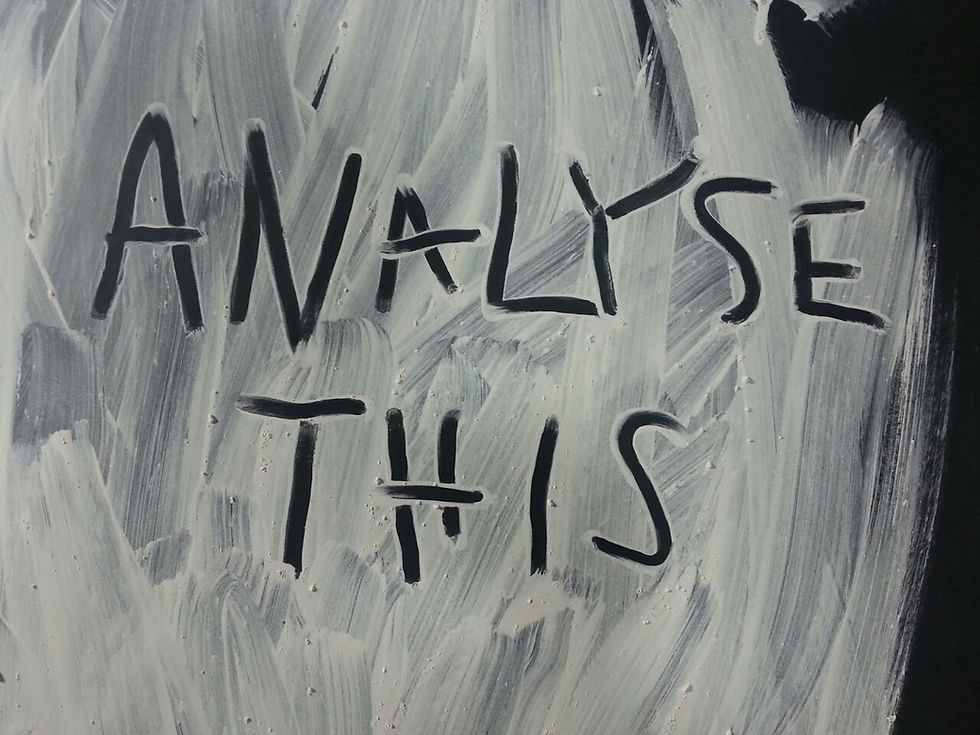

Kommentare