E-Health: Das lange Warten auf den elektronischen Gesundheitsassistenten
- Bülent Erdogan

- 5. Sept. 2018
- 15 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 5. März 2019
Die elektronische Gesundheitskarte soll also in dieser Legislatur wirklich kommen. Vielleicht ebnet die Telematikinfrastruktur manchem Zeitgenossen gar den Weg ins Kanzleramt - verzweifeltes Rütteln an Zäunen könnte dann der Vergangenheit angehören. Wie sähe mein Setup für einen elektronischen Gesundheitsassistenten aus?
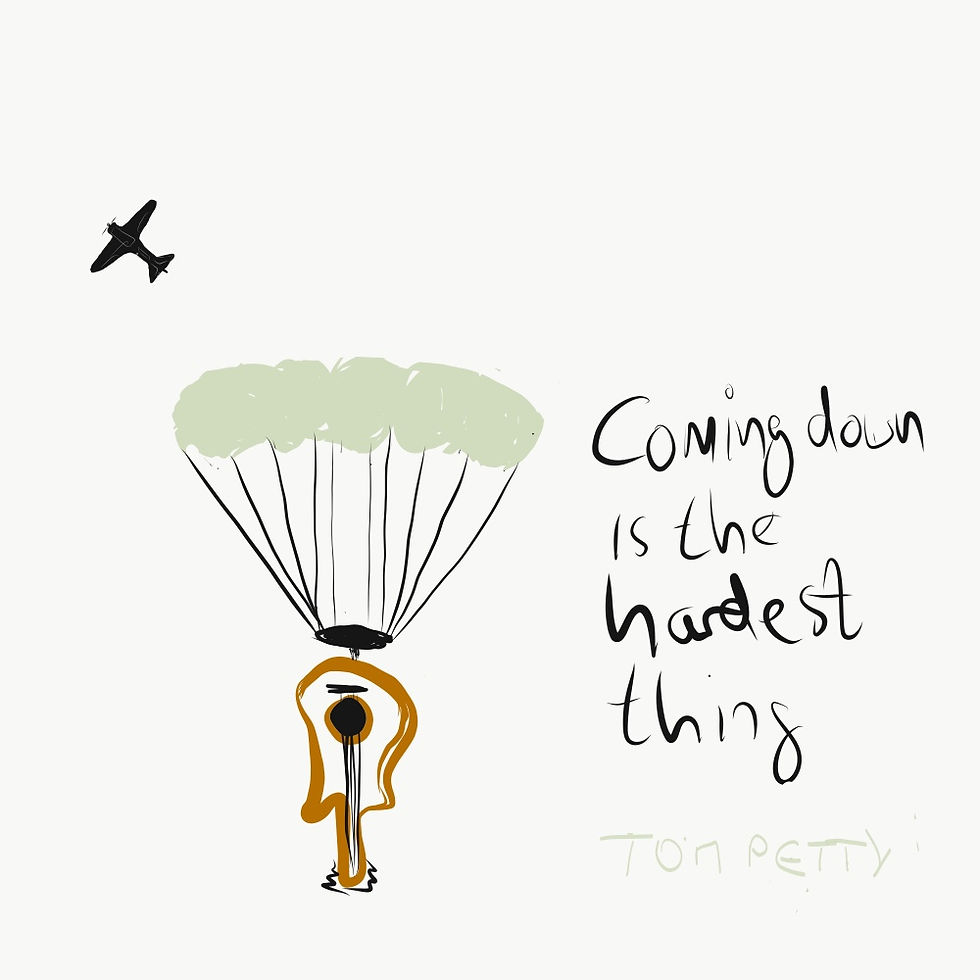
1,8 Milliarden Euro hat die elektronische Gesundheitskarte und das gesamte infrastrukturelle Planen im Drumherum laut NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann seit der politischen Entscheidung zur Einführung einer Telematikinfrastruktur im Jahr 2003 bislang verschlungen. Das sind 1.800 Millionen Euro, eine Summe, die sich durchaus sehen lassen kann: In Köln würde dieser Betrag ausreichen, um die „Tragfähigkeitslücke“, die schlaue Köpfe bei der Stadt Köln für die CCAA mit jährlich 463 Millionen Euro (das sind in etwa zehn Prozent des jährlichen Haushaltsansatzes der Stadt) angeben, für vier Jahre in Folge auszugleichen. Tragfähigkeitslücke: Dahinter verbirgt sich, dass die Stadt von ihrer Substanz lebt und eben nicht genügend Schulen, Kitas, Verkehrswege et cetera baut, sondern das Bestehende übernutzt, vernutzt und abnutzt. Leider lassen Nachrichten wie die folgende noch viel tiefgehendere Probleme im Verwaltungsapparat und Handeln der Stadt vermuten: https://www.ksta.de/koeln/kalk/kalkberg-in-koeln-experte-vermutet-giftige-staubwolken-in-der-luft-31104710 und https://www.ksta.de/koeln/kalk/umweltgefaehrdung-am-kalkberg--ermittlungen-gegen-mitarbeiter-der-stadt-koeln-31156752 und https://www.sueddeutsche.de/politik/nordrhein-westfalen-koeln-eine-unregierbare-stadt-1.4075408?reduced=true.
Als defizitär lässt sich auch die elektronische Gesundheitskarte bezeichnen. Aktuellste "Anwendung"? Der gesetzlich Krankenversicherte als Karteninhaber kann sich mit einem Blick auf sein Passbild davon überzeugen, dass es auch seine Karte ist. Und die Arztpraxis kann per Versichertenstammdatenmanagement (VSDM) hoffentlich schon ab Mitte 2019 prüfen, ob die Karte auch zum Leistungsbezug berechtigt.
2003 schloss ich das Magister-Studium ab, Gerhard Schröder hielt im März seine Blut-Schweiß-und-Tränen-Rede. Seither hat auf informationellem Gebiet vornehmlich das Silicon Valley mit einer Disruption nach der anderen von sich reden gemacht. Auf eine dieser Innovationen, das Smartphone, 2007 mit viel Tamtam von Steve Jobs zum Hosentaschenrenner und Nackendeformierer gemacht, will nun Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (der Dark Knight der CDU und wahrscheinlich unser aller künftiger Bundeskanzler) alle Hoffnungen umleiten, die mit einer Digitalisierung des Gesundheitswesens verbunden werden. Jung genug ist der agile Westfale ja. Und erfahren in stoischer Betrachtung eines fragmentierten und segmentierten, die eigenen Interessen mit Zähnen und Klauen verteidigenden Sammelsuriums an Organisationen, Einrichtungen und Einzelkämpfern, dem wir den Namen Gesundheitswesen gaben.
Wir googlen, whatsappen, facebooken, snapchatten, paypalen, slacken, redditen, instagrammen, multi-leveln, was die Datenautobahn hergibt. Menschen schauen anderen Menschen beim Videospielen zu oder wie sie sich Childish Gambinos Shock-Video ansehen, und immer wieder gibt es neuen „heißen Scheiß“ zu bestaunen, dem wir einen neuen Hashtag verpassen, um ihn auf Twitter, am besten mit unserem Konterfei oder Alias oder Avatar zu branden oder gebrandet zu wähnen. Andy Warhols Diktum von den „15 Minuten Ruhm“ ist mit der linearen Medien-Welt verblasst. Jeder kann heute, in der Währung einiger Millionen Klicks, Ruhm und Ehre erfahren, er kann sie im Zweifel kaufen. Aber es ist ein anderer Ruhm, ein anderer Fame als jener, den ein wagemutiger oder waghalsiger oder humorvoller Auftritt bei „Wetten-Dass?..“ in den 1980ern mit sich brachte. Dieser Ruhm kann medial zwar für einen Moment total sein und zu einem Spill-Over-Effekt führen, aber er ist in seiner Totalität eben auch extrem flüchtig, weil er vom nächsten Hype abgelöst und entwertet wird - in etwa so, wie das bei einem Ticket der Kölner Verkehrsbetriebe der Fall ist, dessen Nutzungsdauer schon mit dem Ausspucken aus dem Automaten abläuft.
Noch Mitte der 2000er hätte ich wohl zum Besten gegeben, dass es absolut sinnvoll ist, Gesundheitsdaten zu sammeln, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, die dann wiederum zu einem rationelleren Einsatz begrenzter Versicherten- und Steuergelder führen und zugleich eine optimierte Versorgung im Einzelfall ermöglichen.
Eine kleine, progressive Gemeinde ist mit Bitcoinen und Derivaten davon beschäftigt (und reich geworden). Wir augmentieren und virtualisieren unsere Realität oder gehen unseren Bankgeschäften online nach (wie war das noch damals mit dem Bildschirmtext BTX?), Programme analysieren in Sekundenbruchteilen und ohne Ermüdung Bilddaten. An ihre Hersteller angebundene Roboter bestrahlen oder operieren (DaVinci, Rosa, Cyberknife M6) oder dienen Kindern und Alten wie im Fall von Zora in Ermangelung von Pflegenden als soziale Kontakte. Noch ist DaVinci in einem Master-Slave-Verhältnis gefangen, aber es ist nur ein Schritt zur Selbstständigkeit.
Protagonisten der Quantified-Self- oder Biohack-Bewegung pflanzen sich Chips unter die Haut, die Bio-Signale aufnehmen und verarbeiten sollen. Der Self-Optimizer und Enhancer Neil Harbisson gilt vielen als erster Cyborg der Welt, seitdem er sich einen antennenartige Konstruktion implantieren ließ. Das eine Ende ist mit einem Chip am Hinterkopf verbunden, das andere Ende schwebt auf Stirnhöhe und trägt einen Sensor, der Farben im Blickfeld in Töne umwandelt. Es gelang Harbisson, seinen Reisepass mit einem Foto verlängern zu lassen, auf dem das „Eyeborg“ wie ein Körperteil zu sehen ist.
In Schweden haben Forscher untersucht, inwieweit sich Augmented Reality bei Menschen mit amputiertem Arm einsetzen lässt, um Phantomschmerzen zu lindern. Dazu befestigten sie Sensoren auf dem Armstumpf, der einem Computer Werte übermittelte, mit dem dieser auf einem Bildschirm den fehlenden Arm simulierte. Diesen setzten die Probanden dann zum Beispiel bei einem Autorennspiel ein.
In einem Smartphone sind heute zwei Milliarden Transistoren verschaltet, um uns in der virtuellen Welt das „beste Erlebnis“ zu bieten. Wir bejubeln „Watson“, wähnen uns am Beginn von „AI“ (siehe auch „Deep Learning ist nicht das Endziel“, Link: www.heise.de/-3998385 und „Die Zeit“ 35/2018, S. 22: „Wenn der Roboter die Fragen stellt“) und schummeln mit "Pseudo-KI", rufen „Alexa!“, machen unsere Homepages responsiv, tragen intelligente Uhren, die ständig Daten senden. Der Tricorder, den der Erste Medizinische Offizier des „Raumschiffs Enterprise“ einsetzte, Dr. Leonard McCoy alias „Pille“, ist in Teilen schon heute Realität, kommt aber nicht ohne reales Nachttisch-Labor aus. Smartphone-gestützte Migränetherapie, Online-Sprechstunde über Kontinente hinweg, Online-Selbsthilfe bei mittelschwerer Depression: "The future was wide open" - sangen einst Tom Petty and the Heartbrakers. Aber auch: „Coming down is the hardest thing.“

Mein Verhältnis zur elektronisch-assistierten Gesundheit, ich benutze hierfür in einem Meta-Sinne weiterhin das Label E-Health, ist heute ambivalent. Es verhält sich ähnlich wie Anfang der 1990er-Jahre, als die schwarzgelbe Koalition auch die Rentenanrechnungszeiten von Schulbesuch und Studium kürzte, um die Beiträge zu „stabilisieren“. Anfangs war ich eher progressive-minded, obwohl ich Helmut Kohl von Herzen ablehnte. Damals machte ich folgende Rechnung auf: Okay, lasst uns als Teilgemeinschaft der jungen Leute, die noch genügend Zeit haben, Rentenansprüche anzusparen, gemeinsam ein paar Opfer bei der Verwirklichung der Einheit bringen, die dann zu positiven Ergebnissen für alle führen, zum Beispiel zu einem geringeren Gesamtschuldendienst des Staates. Denn die Schulden des einen sind die Zinsen des anderen.
So zu denken war natürlich absolut naiv, denn während die einen (also die in der Regel abhängig Beschäftigten) auf Rente verzichten sollten, wurde den anderen (also den wenige Köpfe zählenden Superreichen der Gesellschaft und den laut WiWo insgesamt etwa 1.000 mächtigen Menschen in Deutschland) weiter strukturell das Meiste vom Kuchen der Ausbeutung im Inneren wie im Äußeren zugeschanzt. Dass es unter Gerhard Schröder dann auf dem Terrain des Lebensminimums noch schlimmer wurde mit der Umverteilung von unten nach oben, das konnten wohl nur Insider vorausahnen. Heute ist quasi anerkannt, dass sowohl Bill Clinton als auch Tony Blair sowie Schröder/Fischer neoliberale Angebotspolitik machten. Der Einzelne kann gar nicht so viel von seinem Munde absparen und alle zwei Jahre seinen Untertanenstolz zur Schau stellen, wie beflissene Politiker dann wieder von unten oder der Mittelschicht nach oben umverteilen. Dabei ist alles, wie Baudrillard einst ausführte, leere Signifikanz und Simulacrum.
Noch Mitte der 2000er hätte ich wohl zum Besten gegeben, dass es absolut sinnvoll ist, Gesundheitsdaten zu sammeln, um daraus Erkenntnisse zu ziehen, die dann wiederum zu einem rationelleren Einsatz begrenzter Versicherten- und Steuergelder führen und zugleich eine optimierte Versorgung im Einzelfall ermöglichen. Schon die Argumentation, mit einer Gesundheitskarte, die ein elektronisches Rezept ermöglicht und damit noch vor der Einnahme der ersten Pille vor Kontraindikationen warnen kann und vielleicht ein Leben retten, erscheint isoliert betrachtet auch heute völlig nachvollziehbar. Auch der Gedanke, Untersuchungsergebnisse elektronisch abzulegen, damit Zweit- oder Drittbehandelnde auf sie zugreifen können, ist an sich als vernünftig ableitbar.
Bald aber merkten die ersten Ärzte, was die Elektronisierung des Patientenkontaktes auch mit sich bringen konnte, wenn gewisse Stellen zentral Zugriff auf die Daten haben. Und es formierte sich Widerstand. Was kommt am Ende des Tages bundesweit eigentlich bei all den Kontakten von Ärzten und Patienten in Praxis und Klinik für die populationsbezogene Gesundheit oder bestimmte Patientengruppen herum? Gibt es eventuell Therapeuten oder Einrichtungen, bei denen sich bestimmte, unerwünschte Ereignisse oder „mangelhafte“ Outcomes häufen? Und warum ist das so? Weil bestimmte Ärzte und Kliniken es mit schwierigeren Fällen zu tun haben? Oder weil viele Prozeduren oder Therapien eventuell lediglich auf Voodoo und Koinzidenz beruhen, sprich darauf, dass der besprochene Patient genauso lange krank ist wie jener, der mit grippalen Infekt nicht die Praxis aufsucht? Welchen Schaden richten Überdiagnosen und Überbehandlung an? Was lässt sich eigentlich evidenzbasiert über Medizin überhaupt behaupten und belegen?
In der Medizin gilt ein wunderbarer Grundsatz: Primum nil nocere, secundum cavere, tertium sanare. Erstens nicht schaden, zweitens Leid lindern, drittens Heilen. In gewisser Weise drückt dieses Diktum Stärke wie Schwäche des Arztberufes in einem Satz aus. Für die meisten Erkrankungen gibt es bis heute „lediglich“ symptomatische Therapien. Nicht wenige Krebspatienten haben ihre letzten Wochen mit ex post betrachtet sinnlosen und belastenden Therapien zugebracht, die den Kliniken stabile Einnahmen bescherten, den Tod aber nicht vertagen konnten. Und dann war irgendwann doch „austherapiert“. Über all die Jahre hat die Schulmedizin dem Schicksal aber auch wunderbare Heilungserfolge abgerungen, können Eltern mit ihren Kindern heute herzhaft lachen und Senioren auf ihren Welt-Tourneen fast noch turnerisch toben, weil es Therapien gibt, die Überleben und annehmbare Quality Adjusted Life Years ermöglichen. Kennen Sie noch eine andere Berufsgruppe, die Sie an Ihre Eingeweide oder den Spinalkanal gehen lassen würden? Kennen Sie jemanden, den sie bei einem medizinischen Notfall lieber bei sich wüssten als einen Arzt?
Natürlich waren die kritischen Ärzte gut beraten, für ihre Fundamentalkritik das Bild vom „gläsernen Patienten“ zu zeichnen. In der Tat könnte es für einen Versicherten in der Eigenschaft als Patient kritisch werden, wenn für seine Erkrankung vermeintliches Fehlverhalten als ursächlich angenommen wird. Fehlverhalten würde sich in dem Zusammenhang nach dem jeweils vorherrschenden "Volksempfinden" richten (zu viel/zu wenig/falsche/s/nSchlaf/Sex/Gemeinschaft/Salz/Fett/Zucker/Eiweiß/Fleischkonsum/Milchkonsum/Alkohol/Tomaten/Lightprodukte/Fast-Food/Kaffee/Sport/Stress/Leerlauf/Teilnahme an CDU-Townhall-Meets&Greets). Wenn man dann noch aussagekräftige Informationen in der Hand hätte, umso besser.
Lässt sich die Medizin und die Gesundheitsfürsorge und das Leben so organisieren, dass wir wegkommen von einer intermittierenden Medizin, in der der Patient mit seinem Besuch Phasen der ärztlichen Beschäftigung mit ihm auslöst -, hin zu einer kontinuierlichen, aber nicht bevormundenden Sorge um das gesundheitliche Wohlbefinden?
Übrigens übte sich die rot-grüne Koalition einst in Gedankenspielen die Chronikerregelung so zu staffeln, dass die Belastungsgrenze für Erkrankte bei den Zuzahlungen für Arzneimittel, die gewisse Benchmarks des gesundheitlichen Wohlgefallens nicht erfüllen, bei zwei statt eines Prozents des Einkommens gelegen hätte. Es kam letztlich nicht dazu. Aber Menschen sind ständig auf der Suche nach Mustern, mit denen sie die Welt einordnen können. Und für jedes Muster gibt es die entsprechende Schublade. Hinzu kommt: Während es in der GKV einen Kontrahierungszwang zum einheitlichen Krankenkassenbeitrag gibt, schaut sich die PKV potenzielle Kunden vorher genauer an und richtet die Prämie anhand eines Risiko-Scores aus. Berufsunfähigkeitspolicen werden ziemlich kostspielig oder sie leisten eher dürftig, wenn man nicht quasi unverletzlich ist wie einst ein gewisser Herr Superman. Doch wer garantiert, dass es beim Kontrahierungszwang in der GKV bleibt? (Siehe zur Thematik auch https://www.uni-saarland.de/nc/fr/universite/actualite/article/nr/17009.html)
Aber lassen Sie uns großzügig sein. Wer blickt schon gern verbittert zurück? Aus eigener Ohnmachtserfahrung können Gesundheitspolitiker und Ministeriale ohnehin viel schönere Anekdoten zum Besten geben (Ärzte Zeitung). Zudem schlummert in meiner Seele weiterhin ein fortschrittsaffiner Techie mit Herz für Startups. Und es stellt sich die Frage, ob sich durch eine gute Digitalmedizin der Kontakt mit dem Medizinbetrieb sogar gesundheitsförderlich auf ein Minimum reduzieren lässt? Immerhin hat der US-amerikanische Arzt und Buchautor Eric Topol polemisiert, dass die dritthäufigste Todesursache für Amerikaner aus dem einfachen Faktum des Kontakts mit Medizinern selbst resultiert. Wie auch immer: einen Gedanken Topols erachte ich als sehr interessant: Lässt sich die Medizin und die Gesundheitsfürsorge und das Leben so organisieren, dass wir wegkommen von einer intermittierenden Medizin, in der der Patient mit seinem Besuch Phasen der ärztlichen Beschäftigung mit ihm auslöst, hin zu einer kontinuierlichen, aber nicht bevormundenden Sorge um das gesundheitliche Wohlbefinden? Und zwar in einem Rahmen, der aus uns nicht Gesundheitsrekruten, also Sklaven, oder Ersatzteillager in spe macht? Wenn die Gründe für die Festnahme in Essen stimmen, dann blicken wir zum Beispiel bei der Organspende inzwischen in Abgründe. Der Druck, Organspenden für die „Patienten auf der Warteliste“ zu generieren und das Renommee der Klinik immer wieder aufs Neue zu rechtfertigen, darf nicht zu Dingen führen, die nun im Raume stehen: http://www.fr.de/panorama/uniklinik-essen-patient-stirbt-nach-unnoetiger-lebertransplantation-arzt-in-haft-a-1576552.
Wie sähe nun mein Setup für einen elektronischen Gesundheitsassistenten aus, den ich bei Bedarf und unter strenger Anonymisierung an eine möglichst dezentral organisierte Gesundheitsinformationsstruktur andocken würde? Im Wesentlichen würde es aus folgenden Komponenten bestehen: Heimlabor, Service-Displays in der Wohnung, Sensor (zusätzlich bei Bedarf Wearables oder Pflaster für weitere Anwendungen) und eine Patientenakte. Alle diese Komponenten führen zu einer Anwendung, die ich als Assistenten oder Counselor bezeichnen werde.
Mein Gesundheits-Counselor
1. An einem Platz in der Wohnung steht ein kleines Nachttisch-Labor, wie wir es von einigen Teilnehmern des XPrize Tricorder-Wettbewerbs schon kennen. Dieses Labor ist über ein Kabel mit einem Router verbunden, der als Firewall dient. Da nicht zu erwarten ist, dass ein Sensor-Armband schon alles kann, was ich im späteren Verlauf als Basics ansprechen werde, setze ich bis auf Weiteres auf ein Device unter der Haut, nennen wir es einen Chip. Dieser erfasst, möglichst evidenzbasiert, die medizinisch aussagestärksten Parameter des Geschehens in meinem Körper (Der Traum lebt jedenfalls, siehe https://www.spektrum.de/news/elektronik-die-unter-die-haut-geht/1412927). Das Labor kann von mir selbst bedient werden, um weitere Informationen einzuholen und zu verknüpfen. Der Chip sendet die Daten auf meinen Knopfdruck an der Laboreinheit per Bluetooth an dieses – und nicht per WLAN. Und er muss regelmäßig per Induktor aufgeladen werden (bei einer Smart Watch würde dieser Schritt natürlich entfallen). Neben der begrenzten Reichweite gibt mir das die physische Kontrolle über ihn, ohne ihn gleich panisch herausschneiden zu müssen – ohne nachgeladenen Akku keine Funktion.
2. Mein Assistent gehorcht folgendem Grundsatz: Er wird mich niemals überstimmen oder gar lenken wollen oder gegen meinen Willen mit Dritten kommunizieren in der Absicht, meinen Willen zu umgehen, zu konterkarieren oder zu manipulieren. Allerdings kann ich auf einer Skala zwischen „-3 und +3“ einstellen, wie defensiv oder offensiv mein Assistent mit mir über gesundheitliche oder präventive Themen kommuniziert. „-3“ bedeutet dabei, dass ich den Kontakt mit dem Thema Gesundheit so lange vermeide, bis der Vernichtungsschmerz durch ein Bauchaorten-Aneurysma alles zu spät sein lässt (Die Erwähnung an dieser Stelle mag dem einen oder anderen als polemisch erscheinen, im allgemeineren Kontext möchte ich aber auf Choosing Wisely-Kampagnen von Medizinern und Wissenschaftlern verweisen). Bei „+3“ schläft der Online-Doc quasi mit im Bett. An welchen validen Erkenntnissen mein Assistent diese Skala ausrichten kann, das soll ihm ein Board international rennommierter, selbstverständlich völlig unabhängiger Mediziner und Patientenvertreter nahebringen.
3. Ich wünsche mir einen Assistenten, der mittels zentraler Displays in der Wohnung im Notfall als Counselor agiert. Wenn sich zum Beispiel das Baby verschluckt und zu ersticken droht, dann aktiviere ich meinen Assistenten, in etwa so wie einst Captain Jean-Luc Picard den „Computer“ anrief. Dieser, eventuell als Avatar in den Raum projiziert, stellt mir das korrekte Notfallprotokoll vor und kontrolliert und kommentiert, sofern möglich, ob ich es einhalte. Alternativ dazu ziehe ich eine am Display deponierte VR-Brille an und tauche gemeinsam mit dem Avatar in die reale Situation ein. Mit turnusmäßigen Updates meines Systems stelle ich sicher, dass die Notfallprotokolle up-to-date sind. Gern frische ich mit meinem Assistenten auch meine Erste-Hilfe-Kenntnisse auf. Bis auf den Download der Daten soll das alles offline funktionieren. Auf meinen Zuruf hin meldet der Assistent den Notfall derweil der Rettungsleitstelle.
4. Ich möchte immer kontrollieren können, ob die Kamera und das Mikrofon meines Counselors im Dienst sind. Das jeweilige Display ist von einem abschirmenden Metallgehäuse umgeben, schließe ich dieses, können Kamera und Mikro des Displays nichts mehr aufnehmen und aufzeichnen.
5. Ich wünsche mir einen Assistenten, der erkennt, ob ich über einen längeren Zeitraum zu viel Salz oder (Trans-)Fett oder Eiweiß oder „leeren“ Industriezucker zu mir nehme, an welchem Wert man dies auch immer feststellen kann. Ich möchte über meinen Vitamin- und Spurenelementehaushalt Auskunft erhalten. Und darüber, ob meine Ess-Intervalle anhand meiner Körpermerkmale zur Prognose Anlass geben, das sogenannte gefährliche Bauchfett anzusetzen. Oder ob mein Lightgetränke-Konsum noch in Ordnung geht oder sich schon Probleme ankündigen.
6. Vielleicht kann mein Assistent auch besondere Anfragen an die Mini-Untersuchungs-Kapseln richten, die ich alle fünf Jahre zur Gastro- und Koloskopie schlucke. In Kombination mit einem EKG-Shirt mache ich in jedem Frühjahr meinen Fitness-Check, der mich davor bewahrt, untrainiert mein Herz zu überfordern.
7. Im Sinne eines dezenten und humorvollen Nudgings kann mich mein Assistent durchaus darauf hinweisen, wie viele Hirnzellen ich rechnerisch mit den zwei Flaschen Bier in der Woche gekillt habe und warum ich meine Träume vom Pulitzer- oder Physiknobelpreis nun begraben kann. Allerdings erwarte ich von einem intelligenten Assistenten auch, dass er den positiven Nutzen des moderaten Genusses von Bier in seine Bewertungen einfließen lässt. Wie wir alle inzwischen wissen, machen zumindest Kölsch und Ambroisianum nämlich glücklich, und das liegt eben nicht nur am Fusel.
8. Ich wünsche mir einen Assistenten, der zum Beispiel anhand eines Fotos erkennt, ob die Hautveränderung ein Grund sein könnte, einen Arzt meiner Wahl zu konsultieren – gern auch online (Natürlich müssen wir darauf gefasst sein, dass ein massenhafter Ansturm auf Ärzte via Online-Sprechstunde eben auch dort Wartezeiten auslösen kann. Wenn die Kapazität, also die "Arztzeit", nicht „mitsteigt“, kann das passieren, was passionierte Radfahrer in fortschrittlichen Städten wie Kopenhagen teils schon erleben: Sie stehen im Pulk an der roten Ampel im Stau und müssen geduldig warten, bis der Tross sich mühsam, einer nach dem anderen, in Bewegung setzt. Immerhin ist es trotz allem besser für die Gesundheit). Und der die eigene, datenbankbasierte Einschätzung im Gespräch mit dem Doktor fachlich valide vortragen hilft.
9. Ich wünsche mir einen Assistenten, der mir mitteilt, ob angesichts persönlicher wie von Kohorten-Parametern eher damit zu rechnen ist, dass der langsam wachsende Prostata-Tumor mich überlebt und daher doch eine Therapie angesagt sein könnte oder ob ich ihm mit meinem Ableben zuvorkomme und er mit mir unerkannt verwest. Die Nachwelt kann testamentarisch dann von mir aus per Transfer der Daten an ein Register erfahren, wer die Wette gewonnen hat, mein Assistent oder ich (http://www.degum.de/aktuelles/presse-medien/pressemitteilungen/im-detail/news/krebs-diagnostik.html).
10. Darüber hinausgehend möchte ich meinen Assistenten generell dahingehend einstellen können, ob ich über einen Verdacht auf eine irreversible Erkrankung mit infauster Prognose informiert werden möchte oder eben nicht. Bei Erkrankungen, die sich auf meinen Sohn ableiten lassen, stellen sich wiederum Fragen, die eventuell ihn und seine Zukunft betreffen. Hier ist das letzte ethische Wort noch nicht gesprochen, mir jedenfalls ist keine allgemeingültige Antwort hierauf bekannt.
11. Ich wünsche mir einen Assistenten, der mir sagen kann, ob ich gegen die wichtigsten Infektionskrankheiten noch ausreichend Impfschutz aufbiete. Falls dem nicht so ist, so wünsche ich mir, dass mein Assistent ganz ohne Telefonakquise meinerseits Impftermine eruiert. Doch, halt: lieber telefoniere ich mit meiner Hausärztin statt über diese Services doch zu sehr in ein zentrales System eingebunden zu werden.
12. Noch bin ich als Mitvierziger komplett medikationsfrei, aber falls dem eines Tages nicht mehr so sein wird, wünsche ich mir einen Assistenten, der mich an die richtige Einnahme und die Intervalle erinnert. Mein Chip oder Labor kann bei als wichtig erachteten Therapien auch den Arzneimittelspiegel in meinem Körper bestimmen - oder welches Antibiotikum für die aktuelle Infektion angezeigt ist (und welches nicht in Frage kommt, wenn ich doch einmal eine Unverträglichkeit entwickeln sollte).
13. Mein Assistent soll aus den Erfahrungen, die er mit mir gemeinsam macht, Rückschlüsse ziehen, die Prognosen erlauben. Für diese Prognosen soll er aus allen verfügbaren semantisch erschließbaren Quellen Informationen auswerten, bewerten und, sofern notwendig, Verknüpfungen herstellen. Im Idealfall wird mir mein Assistent zum Beispiel eines Tages sagen können, dass ich wegen meines grippalen Infektes nicht erneut zum Arzt laufen muss, weil meine Rekonvaleszenz bei den letzten zehn Erkrankungen genauso lang oder kurz war wie die nun zu erwartende elfte Rekonvaleszenz ohne Arztbesuch. Oder er wird mir darlegen, dass es so nicht weitergehen kann und ich endlich zum Arzt gehen muss, um die drohende Superinfektion zu vermeiden. Schließlich zählte ich ja keine 20 Lenze mehr, sondern 44. Grundlage für diese Prognose bilden für meinen Assistenten meine Daten sowie die Daten einer vergleichbaren männlichen Patientenanzahl.
14. In meiner Patientenakte sind wesentliche gesundheitliche Informationen vermerkt: Blutgruppe, Impfstatus, Allergien, Kontaktperson, Hausarzt (sofern es noch einen (stationären) gibt). Ich entscheide des Weiteren, ob ich Medikamente, letzte Krankenhausaufenthalte, chronische oder schwere Erkrankungen aufnehme, ebenso darüber, ob ich eine Patientenverfügung dort ablege oder den Fundort angebe oder meine Bereitschaft zur oder die Ablehnung einer Organ- oder Gewebespende dokumentiere. Ich kann mit einem einfachen Befehl alle Daten (für mich) wiederherstellungssicher und in Echtzeit löschen.
15. Für den Fall, dass ich eine chronische Erkrankung entwickele, wünsche ich mir eine Datenbank, aus der ich zum Beispiel vom Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) evaluierte, qualitätsgesicherte Informationen in meinen Assistenten einspeisen kann, die dieser für mich handlungsanleitend und motivierend audiovisuell aufbereitet. Wie wäre es mit den Erkrankungen, die den Morbi-RSA auslösen?
16. Ich wünsche mir einen Assistenten für mein Kind, der mich (beziehungsweise den Kinderarzt bei der Sprechstunde) an den Zeckenbiss im Bergischen von vor sechs Wochen erinnert, wenn mein Kind plötzlich über für mich inzwischen nicht mehr möglicherweise auf den Biss zurückführbare, unerklärliche Symptome klagt.
17. Bei all diesen Aspekten geht es mir im Grunde genommen darum, dass alle Informationen, die vorhanden und bewertbar sind, zumindest in Betracht gezogen werden. Dabei ist die Kautele zu reflektieren, dass KI auf semantischer Basis nur das erfassen kann, was ihr in geeigneter Form vorliegt.
Bei allem stellt sich auch die Frage, wie viel technologischer Aufwand für welches Resultat noch als sinnvoll erachtet werden kann? Und ob es nicht sinnvoller sein kann, statt in einen Reparaturbetrieb, die SGB-V-Garage, in ein gesundes (Arbeits-)Leben zu investieren.
18. Viele Hinweise liegen bereits vor, das sind zum Beispiel die BQS-Daten. Ich möchte zumindest wissen, ob ein Krankenhaus eine überdurchschnittlich hohe Komplikations- oder gar Mortalitätsrate aufweist und Rehospitalisierungen an der Tagesordnung sind. Hierüber soll mein Assistent mir Auskunft geben können. Ich kann dann immer noch eruieren, ob die höheren Raten unerwünschter Ereignisse daraus resultieren, dass die Patienten von Klinik X im Schnitt kränker sind und kompliziertere Operationen benötigen und die Risikoadjustierung nicht ausreichend war. Oder ob dort eine Klinik agiert, die eben nicht auf ärztlich als sinnhaft erachtete Mindestmengen kommt. Wie so oft, so steht auch hier die Frage nach Ursache und Wirkung im Raume (https://www.barmer.de/presse/infothek/studien-und-reports/krankenhausreport; und für die andere Perspektive: https://www.dkgev.de/dkg.php/cat/38/aid/40241).
19. Ob ich mir einen Assistenten wünschen soll, der auch eine depressive Episode oder einen Bore Out voraussehen kann - und es mir dann auch mitteilt? Ich weiß es nicht. Ob mein Assistent wegen der Wechselwirkung zwischen Beziehung und Gesundheit auch Partnerberatung anbieten sollte, wenn er es könnte?
Epilog
Eine Medaille hat bekanntlich zwei Seiten, die sechs Seiten eines Würfels will ich an dieser Stelle lieber nicht bemühen, auch wenn mir mindestens sechs Dimensionen für das Gesundheitswesen als etwas zielführender erscheinen. Die Seite des an seinem Wohlbefinden interessierten Menschen und Patienten in spe habe ich oben kurz angerissen. Auf der anderen Seite der Medaille stehen diejenigen, die mir später eventuelle einmal Therapien angedeihen lassen möchten - die Doctores.
Vorstellbar und teils schon Realität sind Formen der digitalen Unterstützung und des Counselings. Das könnte schon in der Ausbildung beginnen, wenn Lehrinhalte dreidimensional aufbereitet werden. Im späteren Arzt-Patient-Kontakt könnte ein Counselor als Coach/Partner/Reminder für bestimmte Kommunikationssituationen dienen. Das betrifft zum Beispiel das in der Regel in der Kindheit abtrainierte Stellen offener Fragen („Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm“) oder den geschickten Einsatz von Pausen, Paraphrase, Echoing, Zusammenfassung, Behandlungsvertrag, auf den es eben ankommen kann, wenn der Kontakt mit dem Patienten erfolgreich verlaufen soll. Lässt sich durch digitale Unterstützung eventuell „Arztzeit“ zurückgewinnen?
Bei allem stellt sich auch die Frage, wie viel technologischer Aufwand für welches Resultat noch als sinnvoll erachtet werden kann? Und ob es nicht sinnvoller sein kann, statt in einen Reparaturbetrieb, die SGB-V-Garage, in ein gesundes (Arbeits-)Leben zu investieren, also in gehorsamsfreie Erziehung, in eine andere Schulbildung und Ausbildung, in als lohnend empfundenes tägliches Tagwerk und Phasen der Erholung und Sinnsuche oder -bestätigung, in gesunde Städte, in eine als gerecht empfundene Gesellschaft, in internationale Gerechtigkeit? Die Weltgesundheitsorganisation WHO jedenfalls geht in einer Schätzung für das Jahr 2012 von mehr als zwölf Millionen Toten in Folge solcher exogener Faktoren weltweit aus, davon circa 1,4 Millionen in Europa. Weltweit wäre das mehr als jeder fünfte Todesfall. 85 der 102 großen Erkrankungen („major diseases“), die im Weltgesundheitsreport beleuchtet werden, seien zumindest teilweise auf Umwelteinflüsse zurückzuführen. So sollen laut einer Analyse der Global Burden of Disease-Studie etwa 30 Prozent aller durch Schlaganfall verlorenen gesunden Lebens- jahre weltweit mit der Luftverschmutzung in Umwelt und Haushalten assoziiert sein (Lancet Neurology, 2016; doi: 10.1016/ S1474-4422(16) 30073-4).
Wir, die wir aktuell in irgendeiner Position und Betätigung uns wiederfinden, werden die Antworten auf Fragen wie diese wahrscheinlich nicht finden. Aber es besteht schon eine gewisse Sehnsucht danach, wenn Menschen nach Dänemark blicken und sich dort ein Wort ausleihen, das man auch dem Bundesgesundheitsminister gern in seine Kabinettsklausur-Kladde schmuggeln möchte: Hygge.

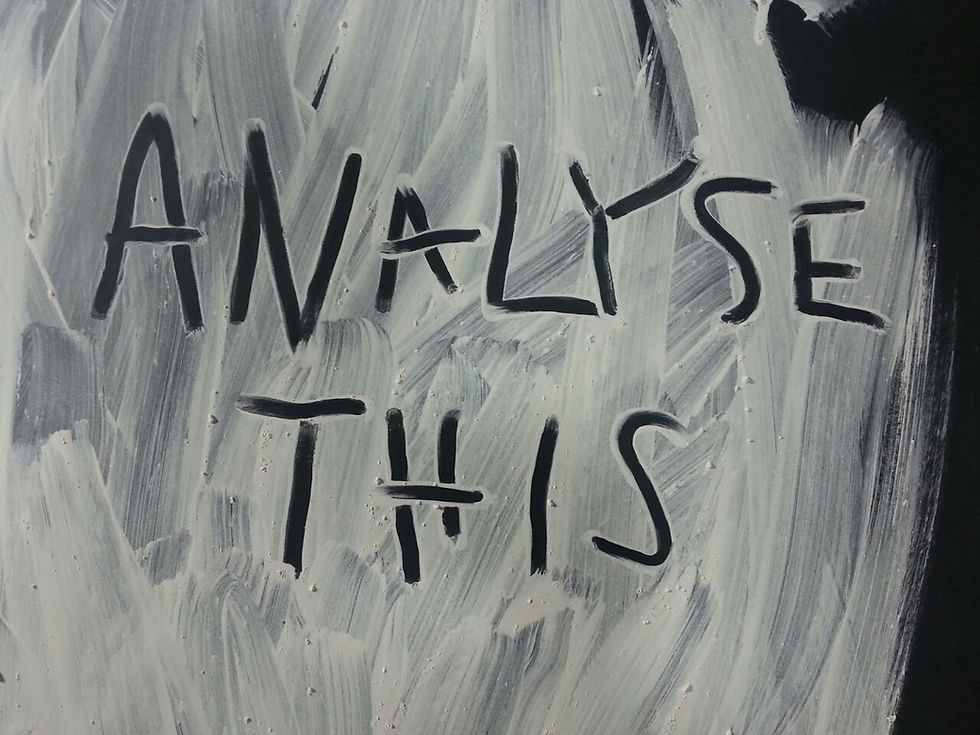

Kommentare