Beziehungsstatus: Es ist kompliziert
- Bülent Erdogan

- 31. Aug. 2018
- 7 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 26. März 2023
Um die 20 Kilogramm: So "schwer" wird ein Kopf, wenn der Träger ihn vornüber beugt, um in sein Smartphone hineinzuschauen. Bei mir hat die Beschäftigung mit dem "Internet" in den Achtzigern begonnen. Damals hatte ich aber noch keine Ahnung. Wahrscheinlich hat sich das bis heute nicht großartig verändert.

Meinen allerersten Kontakt "mit dem Internet“ hatte ich Anfang der 1980er. Damals besuchten meine Eltern und ich Opa in der Uniklinik der RWTH Aachen. Der ließ sich in Aix-en-Skalpell schmerzhafte Nierensteine zertrümmern oder herausoperieren, das genaue ärztliche Bulletin ist mir nie unter die Augen gekommen. Wie auch immer, in der Wandelhalle des futuristischen Baus waren die wahrscheinlich bundesweit ersten BTX-Terminals aufgestellt. Ich nahm die Geräte zur Kenntnis, konnte aber nichts weiter mit ihnen anfangen. Wie viele andere verwechselte ich dann den „Videotext für Alle“ mit BTX. Egal: der Fortschritt war auch in unser landkölnisches Wohnzimmer gekommen, der fernsehlose Nachmittag durch Videotext in neue Sphären erhoben.
Meine ersten Schritte „im Internet" habe ich viele Jahre später unternommen. Im Spätsommer 1994 richtete ich mir als Ersti an der Bibliothek der Uni Bonn ein E-Mail-Konto beim Anbieter Hotmail ein. Auch bald 30 Jahre später dient es mir als elektronisches Hauptpostfach, während mein Post-Briefkasten seitdem an sechs verschiedenen Straßen gestanden hat. Zuvor hatte ich mir mit meinem ersten Geld als Werkstudent, stolzen 2.000 D-Mark, bei Atelco auf dem Hohenzollernring in der Kölner City einen 486er zugelegt, mit einer Taktung von 40 Megahertz und einer Festplatte von 60 Megabyte. Bye, bye Amiga 500, herzlich willkommen, PC-Welt.
Die nächste Erinnerung an das Web 1.0 datiert aus dem Sommer 1995. Krzysztof führte uns Kumpels in die Welt der Modems ein: Ich holte mir auch eines von diesen fiependen Dingern, die die Telefonleitung blockieren und Krzysztof pingte mich verabredungsgemäß an – mein erster Chat, schwarzer Hintergrund, weißer Cursor, MS-DOS at its best. Ich begriff den Ernst der Lage nicht, fand die Situation absurd. Es entwickelte sich lediglich eine kurze Konversation. Danach haben wir uns lieber wieder persönlich getroffen (siehe so ähnlich auch Yuval Noah Harari: Homo Deus, München 2017, S. 74). Überhaupt war es eine Zeit, in der ein unvermittelter Kojak-Schnitt meines Freundes Marek oder dessen legendärer Aufgalopp mit der Chopper mehr Fame brachte als jeder Post es zu tun vermocht hätte.
Im April 1996 las ich bei Frank auf "SPON" über die Brandkatastrophe am Düsseldorfer Flughafen. 1997 lernte ich das Akronym WYSIWYG, scheiterte aber an der User-Oberfläche von Front Page. Dann lieber andersherum und HTML pauken. Gottes Lohn und Pein manifestierte sich in zwei Tags:
<table>
…
</table>
und dem Konzept, Tabellen in Tabellen hineinzubauen, um auch komplexere Strukturen anzeigen zu können. („Warum ist die scheiß‘ Seite kaputt? Wo ist das Problem? Ich habe doch alles kontrolliert, wo fehlt denn da der Tag? Warum? Warum! Waarrrruummm!!!“ Stunden später: „Ah, die Klammer fehlte. Sieht doch gut aus. Okay, jetzt mal mit Netscape Navigator. So ein Mist, immer das Gleiche mit dem Browser. Sollen die zehn Prozent doch zu IE wechseln!“)
Auf die ersten Jahre heißer Liebe, inklusive Armageddon-Thrill und Moorhuhn zum Millenium, folgte die Zeit der Ermüdung: Irgendwann fühlte es sich an, als ob dieses Internet 1.0 (Homepage, E-Mail-Formular, Gästebuch, Forum) aus den immer gleichen mutistischen Angeboten bestand – Spiegel.de, Kicker.de, AutoBild.de, KStA.de, KR-Online.de, das Effzeh.de/Forum und die Auseinandersetzungen mit Anhängern der Partei Die Republikaner auf dem SPD.de/Forum, gelegentliche Ausflüge auf NYT.com, Hurriyet.com.tr, NZZ.ch, FAZ.de oder FR.de – und ich wie ein Junkie den F5-Knopf malträtierte. Napster war zeitweise wirklich ein "heißer Scheiß'", die Lieder mit ihren vier oder fünf Megabytes relativ schnell heruntergeladen.
Eine Zeit lang machten RSS-Newsfeeds die Sache mit den Infos im Netz wieder etwas reizvoller. Aber in toto war das Internet Mitte der 2000er eher zu einer mauen Angelegenheit mutiert. So sexy wie die Mittagspause. Das lag auch daran, dass man Napster längst an die Kandare genommen hatte. Auch die ersten massenverkäuflichen Flachbrettbildschirme der 17-Zoll-Kategorie („Nächste Woche bei Aldi!“) und andere kurze Zeitvertreibe wogen das alles nicht auf. Es fehlte so etwas wie ein „Marktplatz“, ein „Schwarzes Brett“, ein „Fernglas“, mit dem sich auf einen Blick nachschauen ließ, was die anderen so treiben und wie sie es tun. So wie man als Kind durch das Fenster beim Opa in die gegenüberliegenden Küchen spannte und die Phantasie um Welten größer war als das, was sich dann real die paar Meter da drüben über der Straße abspielte. Es fehlte, wenn man nicht eine eigene Internetseite betrieb, an „Interaktion“, also der consumerseitige Pushfaktor.
In diese Leere preschte Ende 2005 in Deutschland StudiVZ. Ich nutzte es zwar nicht, war aber über meine Frau recht gut über die Vorgänge in der alten Heimat (wir waren 2007 nach Berlin gezogen) informiert oder bildete mir dies jedenfalls ein. Irgendwie machte mir StudiVZ sogar Angst, weil Menschen, die hunderte Kilometer weit entfernt lebten, mit einem Klick in der Lage waren, einem ein schlechtes Gewissen einzureden („Warum seid Ihr beim letzten Heimaturlaub nicht auch zu UNS gekommen?!“). Ich wollte das alles nicht.
Damals gab es Facebook schon. Diese Story ist bekannt, die Geschichte wird von Siegern geschrieben. Den zweiten Band der West-Coast-Saga schrieb Steve Jobs 2007 mit dem iPhone („Project Purple“). Zuerst nutzte meine Frau Facebook, während ich noch über Datenschutz sinnierte und eine hochnäsige Ablehnung zur Schau trug. Als wir uns getrennt hatten, musste ich mir dann wohl oder übel einen eigenen Account zulegen. Das war im Jahr 2013. Zunächst wollte ich schlauer sein als der Rest und versuchte es mit Xing. Aber da war nichts los.
Also, dann doch Facebook. Gleich mit meinen ersten Posts kleisterte ich die Time Line mit einer dreistelligen Zahl an Fotos zu. Von Instagram hatte ich noch nichts gehört. Weil mir alles irgendwie auch peinlich war, also, vor allem das Gefühl, bei anderen als verrückt oder egozentrisch anzukommen oder Nabelschau zu betreiben, schränkte ich den Empfängerkreis meiner Posts sehr schnell auf etwa drei Dutzend Menschen ein.
Facebook veränderte in der Tat vieles in meinem Single-Leben, es war Ohr und Auge am Puls der Zeit, es vermittelte mir die Illusion, Teil einer Community zu sein. Das war nicht immer einfach, denn zwischen dem letzten Kontakt im realen Leben und der Freundschaftsanfrage lagen mitunter zwei Jahrzehnte. Immer wenn das gelbe Lichtlein meines Handys ein neues Post signalisierte, griff ich hastig zum Nachttisch, mein leichter Schlaf kam mir dabei zugute. Ich teilte Youtube-Videos über die Gezi-Proteste und wähnte mich bei der nächsten Türkei-Reise deshalb schon im Knast. Ich informierte mich über reale soziale Aktivitäten („Kalk für Alle“), über die ich schließlich meine heutige Partnerin kennenlernte, mit der ich nun eine Kleinfamilie betreibe. Einen Heidenspaß bereitete wahrscheinlich nicht nur mir die Künstler-Seite "KInder raus aus Deutschland", kurz "Krad", die alle Stereotype gegenüber Minderheiten mit ihren Postings persiflierte.
2016 dann das Menetekel der "Silvesternacht von Köln": meine Time Line explodierte geradezu, verzweifelt stemmte ich mich mit anderen gegen die Welle des Hasses und der Ignoranz. Meine Journalistenkollegen überboten sich geradezu mit abenteuerlichen und naiven Fragestellungen. Schnell war das Bild gemalt von den 1.000 Syrern, Irakern und Nordafrikanern, die in Bataillonsstärke "unsere Frauen" vergewaltigen wollen und sich dazu via Social Media (WhatsApp et cetera) verabredet hätten. Es gab kein Halten mehr. Es gab auch quasi niemanden mehr, der sich die Frage gestellt hätte, warum gerade die Domumgebung wie ein Magnet wirkte?
Nun, ein Grund lag auf der Hand: der Kölner Dom ist das wahrscheinlich bekannteste Bauwerk in Westdeutschland. Er liegt direkt an einem der größten Bahnhöfe Deutschlands. Menschen aus dem Nahen Osten, die in Deutschland zum Beispiel unterschiedlichen Städten zugewiesen worden waren, trafen sich in der größten Stadt NRWs am größten Bauwerk der Stadt. Der Bahnhofsvorplatz mag nicht der beste Fleck für das Silvesterfeuerwerk sein, für Ortsfremde ist er aber ideal, auch als Entrée in die City. Hinzu kamen Alkohol, Böller, die übliche, peinliche Silvesterstimmung, Männerüberschuss, einige böse Menschen - und die Absenz von Polizei. Eine Hundertschaft an Polizei, noch dazu in Habitus und Aufgabenbeschreibung aufgesplittet in Bundes- und Landespolizei, für eine Partyzone von mehreren Quadratkilometern (Hauptbahnhof, Altstadtkneipen, Kunibertviertel, Friesenviertel, Ringe), auf denen sich hunderttausende Menschen bewegen, ist einfach viel zu wenig. Allein um die Hohenzollernbrücke auf beiden Seiten zu kontrollieren oder zu räumen, bräuchte es an allen vier Zugängen ausreichend (Bereitschafts- bzw. Bundes-)Polizei.
Ein mir aus meiner Heimatstadt bekannter User wünschte mir im Laufe der Diskussion über die Ereignisse, dass doch auch meine Freundin mal vergewaltigt werden sollte. Offenbar hatte er meine Meinung als Verharmlosung der Ereignisse missverstanden. Immerhin gelang es mit gemeinsamen Kräften, mit einem Aufruf auf Facebook eine kleine aber feine Willkommensinitiative in Kalk zu gründen und dem Mainstream, ja, der herrschenden Meinung über die Ereignisse auf dem Bahnhofsvorplatz, im Kleinen etwas entgegenzusetzten. Einige Monate darauf malte sich ein anderer User, wahrscheinlich im Suff oder ähnlichem, meinen Tod aus. Am nächsten Tag schrieb ich dem Internet-Hool eine PN und gab mich als türkischen Juden aus. Ob es der ausgeschlafene Rausch oder ein Rest an Holocaust-Reue war? Jedenfalls entschuldigte sich der Volksrächer. Andere wurden meine "Freunde" und hetzten über andere Ausländer. Dieses Doppeldenk kenne ich, seit ich denken kann. "Jeder Nazi hatte seinen Lieblingsjuden" und "Nazis essen heimlich Döner", heißt es ja auch.
Meine Stimmung hellte sich 2016 kaum mehr auf und daran hatte Social Media ein gerüttelt Maß an Verantwortung. Aber es gab ja auch nicht mehr viel zu lachen 2016, wenn man an die Ereignisse in der Türkei im Sommer oder an das Spektakel namens Präsidentschaftsbingo in den Vereinigten Staaten im Herbst denkt. Im Nachgang der US-amerikanischen Wahlposse stieß ich via Time Line von Facebook immerhin auf interessante News-Angebote wie „The Intercept“, „Politico“ oder „The Atlantic“.
Den ersten Internet-Shit-Storm erlebte ich allerdings schon weit früher mit, und zwar im November 2000. Im sächsischen Sebnitz war 1997 im dortigen Schwimmbad ein Junge ertrunken. Drei Jahre später nahm der Staatsanwalt Ermittlungen auf, weil angeblich Neonazis den Jungen mit deutschen und irakischen Wurzeln ertränkt und viele Badegäste die Tat gedeckt hätten. Die BILD-"Zeitung" nahm sich des Falles an und schlüpfte in die Rolle des Richters und Henkers. Ich erinnere mich, wie ich damals ebenfalls zu jenen gehörte, die der Stadt eine böse Mail schrieben. 2001 stellte der Staatsanwalt das Verfahren ein. Ein Lehrstück über Journalismus und unsere Gesellschaft, wie folgende Artikel aus den Jahren 2000 und 2010 aufzeigen: SPIEGEL ONLINE und Die Zeit.
Heute, und immerhin 353 Facebook-„Freundschaften“, diverse Gruppenmitgliedschaften und viele, viele letztlich sinnlose, noch dazu nicht mehr auffindbare Thread-Battles mit Internet-Suprematisten (“Don‘t Feed The Trolls!“) später, kommt auf meinem Handy zu Zuckerbergs Werbeplattform noch Zuckerbergs Instagram und WhatsApp sowie Twitter hinzu, Xing und LinkedIn sind ebenso an Bord wie Behance auf Adobe Creative Cloud. Die eine oder andere „wirklich“ nützliche App komplettiert den Wahnsinn. Und es stimmt: Twitter ermöglicht mir zu verfolgen, was Leute heute machen, die ich vor Jahren vielleicht mal in ihrer Funktion als Journalisten oder Publizisten gelesen habe. Einer von ihnen ist Owen Jones, Autor des Buches "Chavs". Er ist heute eine der Hauptfiguren der englischen Linken, zumindest im Social Web.
A propos Social: Während ich diese Zeilen zu Ende bringe, sitze ich in der zweiten Präsenzphase meines Zertifikatslehrgangs an der TH Köln zum Social Media Manager. Ich erfahre Dinge über APIs, Crawlers, Bounce Off Rates, Metriken, Entities, KPIs, Share of Voice, Daypart, Conversions, Search Strings, Skalierbarkeit, Content Hubs, Reserved Buy, Targeting et cetera pp. Und ertappe mich dabei, wie ich immer wieder an eine Puppe denke, in die ich kleine Nadeln stecke. Denn ohne kontinuierliche, massenhafte Überwachung wäre Social Media eben kein Geschäft. Weiß auch Google und trackt uns auch bei ausgeschalteter Option etwa 300 Mal am Tag. Adorno? Adorno!

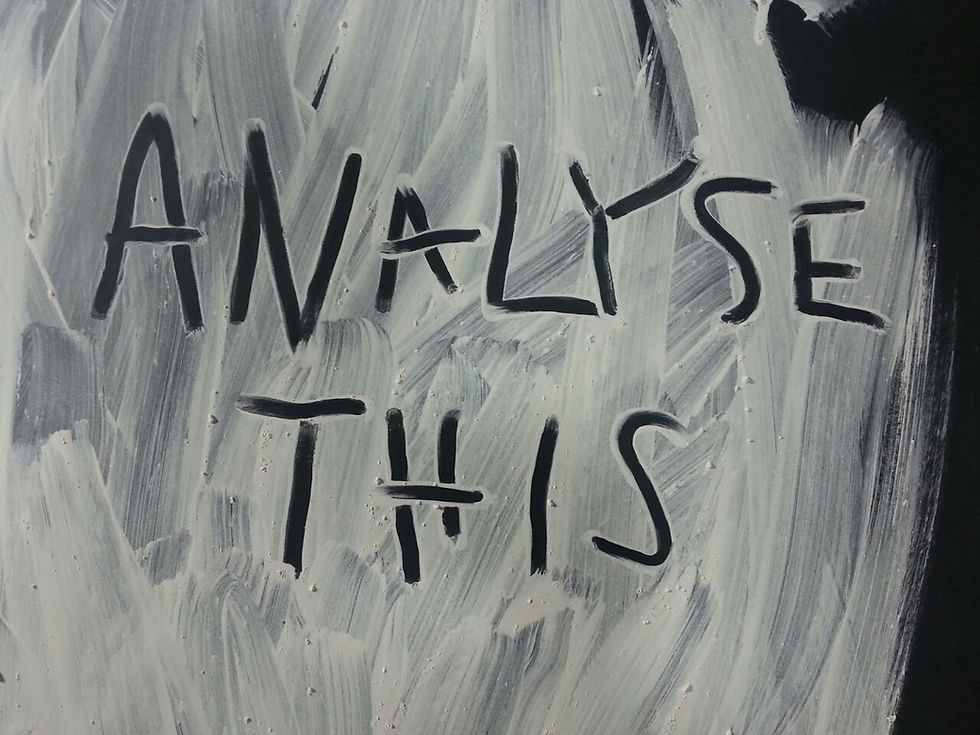

Kommentare